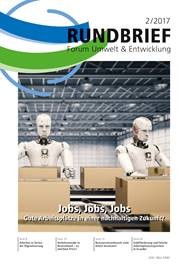
Es ist Wahlkampfzeit und das Thema Arbeitsplätze steht somit ganz oben auf der politischen Agenda. Wie vor jeder Wahl fragen sich die Menschen, welche Weichen ihre künftige Regierung stellen wird, damit sie in Arbeit bleiben oder zu Arbeit kommen. Dabei geht es nicht nur um die Beschäftigungsquote, sondern vor allem auch um die Qualität der Arbeitsplätze, jetzt und in der Zukunft. Neue Technologien, die Digitalisierung, die fortschreitende Globalisierung und der damit einhergehende Strukturwandel stellen uns vor große Herausforderungen.
So befürchten einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebenen Studie zufolge 81 Prozent der Menschen in Deutschland, dass durch die technologische Entwicklung immer mehr Menschen beruflich abgehängt werden. Glaubt man Angela Merkel, geht es beim Thema Arbeit jedoch zuerst um Innovation und dann um Gerechtigkeit. Letzteres müsse sich aus den Innovationen entwickeln, so die Kanzlerin nach dem Wahlsieg ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017. Aber wie können wir es zulassen, dass sich Innovation und Gerechtigkeit ausschließen? Ist nicht der Sinn von Innovation, das Leben der Menschen zu verbessern? Verbesserung für wen ist hier wohl die Frage.
Es ist doch schizophren: Deutschland geht es so gut wie nie. Es gehört zu den reichsten Ländern der Welt und dennoch wächst hier die soziale Ungleichheit schneller als in jedem anderen Industrieland. Geschuldet ist dies vor allem der zu einseitigen Gewinnverteilung zugunsten von Unternehmen und der neoliberalen Deregulierungspolitik gleichermaßen auf den Arbeits-, Finanz-, Güter- und Dienstleistungsmärkten.
Diese Entwicklung vollzieht sich weltweit. An vielen Orten mit sehr viel drastischeren Auswirkungen als in Deutschland, aber durch unsere Arbeits- und Wirtschaftsweise mitverursacht. Im Namen der Wettbewerbsfähigkeit werden Arbeitsplätze z. B. dorthin ausgelagert, wo die Lohnnebenkosten am niedrigsten sind. Sozialdumping im globalen Maßstab geht dabei oft mit Prekarisierung, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und der Unterdrückung von Gewerkschaften einher. Ein Produkt wird zudem kaum noch in einem einzelnen Land geschaffen, sondern entsteht häufig aus hunderten Einzelteilen entlang globaler Produktions- und Lieferketten, in denen organisierte Verantwortungslosigkeit herrscht. Verbunden ist dies mit enormen Umwelt- und Klimaproblemen, zulasten zuerst der Menschen im Globalen Süden.
Überhaupt dürfen wir über die Zerstörung der Natur – unserer Lebensgrundlage – nicht schweigen, wenn wir über Arbeit und Zukunft reden. Dabei wiegt die Angst vor wegfallenden Arbeitsplätzen oft schwer, wie sich z. B. beim Ausstieg aus der Kohleförderung und anderen fossilen Rohstoffen zeigt. Die Chancen der Energiewende und Möglichkeiten politischer Instrumentarien wie einer ökologischen Steuer- und Finanzreform bleiben dabei oft viel zu ungenau analysiert, wenngleich schwer vorhersagbar. Auch im Verkehrssektor stellt sich die Frage, welche politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, um eine umwelt- und klimafreundliche Industriepolitik zu ermöglichen, die auch den Wandel für die Beschäftigten in der Branche berücksichtigt. Das Thema Arbeitsplätze verknüpft also unausweichlich soziale, ökologische und wirtschaftliche Belange und berührt dabei immer auch die Frage nach Gerechtigkeit – nicht nur lokal, sondern auch global. Einfache Antworten gibt es nicht. Einige Denkanstöße und Lösungsansätze möchte diese Ausgabe des Rundbriefs dennoch geben.
Josephine Koch
__________________________________________________________________________________
Inhalt
SCHWERPUNKT
Gute Arbeit, schlechte Arbeit, keine Arbeit – Das Arbeitsplatz-Argument zwischen Tatsachen und Spekulation
Jürgen Maier
„Jobwunder“? – Folgen der neoliberalen Arbeitsmarktpolitik
Patrick Schreiner und Joshua Seger
Energiewende und Klimaschutz – Chancen und Risiken für mehr Beschäftigung
Dr. Ulrike Lehr
Arbeit 4.0 – Menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen in Zeiten der Digitalisierung
Sven Hilbig
Die Transformation im Automobilsektor wird kommen – Aber zu welchem Preis für die Beschäftigten?
Chi Huy Tran-Karcher
Ressourcenverbrauch statt Arbeit besteuern – Über die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzreform
Björn Klusmann
Zukunft einer nachhaltigen Nahrungsmittelindustrie – Betriebs- und industriepolitische Instrumente am Leitbild Guter Arbeit
ausrichten
Dr. Melanie Frerichs
Faire Globalisierung braucht starke Gewerkschaften und Tarifverträge – ArbeitnehmerInnenrechte weltweit stärken
Stefan Körzell
Mensch oder Marke: Was ist mehr wert? – Knappe Frage und komplexe Antwort, doch Komplexität ist kein Argument für’s Nichtstun
Berndt Hinzmann
Die wirtschaftliche Schizophrenie des Menschen – Der Yasuní-Nationalpark in Ecuador und die Erdöljobs
Patricio Chávez
________________________________________________________________________
AKTUELL
Open Source für Saatgut – Eine Alternative zu Patenten und Sortenschutz
Ursula Gröhn-Wittern
Ökosysteme als Dienstleister für den Menschen? – Wirtschaftliche Argumente gegen den Naturverbrauch
Helge Swars und Susanne Rewitzer
Schöne neue Digitalisierung – Warum dahinter eine Gefahr für unsere Demokratie steckt
Marie-Luise Abshagen
Verbindliche staatliche Kennzeichnung für alle tierischen Produkte – Ein erster Schritt zum Umbau der Tierhaltung
Katrin Wenz
Das NGO-Netzwerk der UNCCD – Gemeinsam für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung
Assoz. Prof. Baris Karapınar
____________________________________________________________________________
THEMEN UND AGs
Shrinking Spaces – schrumpfende Handlungsräume der Zivilgesellschaft – Über Ursachen, Auswirkungen und Lösungswege
Josephine Koch
Rechtsschlappe für die EU-Kommission – Europäischer Gerichtshof stärkt Partizipation der BürgerInnen und Mitspracherecht der EU-Mitgliedstaaten
Nelly Grotefendt
Civil 20 – ein globales Dialogforum vor dem G20 – „The World We Want“
Jürgen Maier
Auf dem Weg zum 8. Weltwasserforum in Brasilien – Wasserbewegte diskutieren in Den Haag
Birgit Zimmerle
Charta für Holz 2.0 – Mehr Holzbau trotz knapper Reserven
László Maráz
Runbrief bestellen unter info@forumue.de
